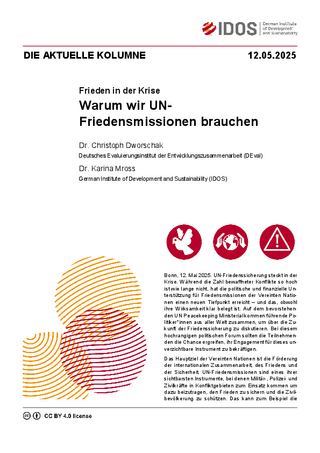Frieden in der Krise
Warum wir UN-Friedensmissionen brauchen
Dworschak, Christoph / Karina MrossDie aktuelle Kolumne (2025)
Bonn: German Institute of Development and Sustainability (IDOS), Die aktuelle Kolumne vom 12.05.2025
Bonn, 12. Mai 2025. UN-Friedenssicherung steckt in der Krise. Während die Zahl bewaffneter Konflikte so hoch ist wie lange nicht, hat die politische und finanzielle Unterstützung für Friedensmissionen der Vereinten Nationen einen neuen Tiefpunkt erreicht – und das, obwohl ihre Wirksamkeit klar belegt ist. Auf dem bevorstehenden UN Peacekeeping Ministerial kommen führende Politiker*innen aus aller Welt zusammen, um über die Zukunft der Friedenssicherung zu diskutieren. Bei diesem hochrangigen politischen Forum sollten die Teilnehmenden die Chance ergreifen, ihr Engagement für dieses unverzichtbare Instrument zu bekräftigen.
Das Hauptziel der Vereinten Nationen ist die Förderung der internationalen Zusammenarbeit, des Friedens und der Sicherheit. UN-Friedensmissionen sind eines ihrer sichtbarsten Instrumente, bei denen Militär-, Polizei- und Zivilkräfte in Konfliktgebieten zum Einsatz kommen um dazu beizutragen, den Frieden zu sichern und die Zivilbevölkerung zu schützen. Das kann zum Beispiel die Unterstützung bei der Entwaffnung ehemaliger Kämpfer*innen, die Ausbildung von Polizeikräften, oder den Abbau illegaler Checkpoints einschließen. Alle Missionen erfordern sowohl ein Mandat des UN-Sicherheitsrats als auch die Zustimmung des Einsatzlandes.
Der Bedarf an Friedenssicherung ist groß, aber die Unterstützung schwindet. Die Zahl bewaffneter Konflikte hat 2023 einen neuen Höchststand erreicht. Humanitäre Krisen verschärfen sich und unzählige Menschen kommen in Konfliktgebieten ums Leben. Dennoch werden die Mittel für Friedenseinsätze der Vereinten Nationen Jahr für Jahr gekürzt. Das Budget ist in den letzten zehn Jahren um mehr als ein Drittel geschrumpft. Gleichzeitig zeugen prominente Fälle wie Israels vorsätzlicher Angriff auf UN-Friedenstruppen und die bröckelnde Unterstützung durch Gastländer von der Legitimationskrise der UN-Friedenssicherung. Diese Entwicklungen sind nicht überraschend in einer Zeit, in der die internationale Zusammenarbeit und ein gemeinsamer Sinn für globale Verantwortung zunehmend nationalistischer Politik und populistischer Rhetorik weichen.
Friedenssicherung ist gewiss kein Allheilmittel. Fallstudien werfen wichtige Kritikpunkte auf, etwa mangelnde Kontextsensibilität. Dabei zeigen sie Reformbedarf auf und weisen auf Probleme und Schwächen bekannter Missionen, wie in der Demokratischen Republik Kongo, hin. Gleichzeitig gibt es Vorwürfe, dass die Friedenstruppen nicht genug für den Schutz der Zivilbevölkerung getan hätten. Alles in allem könnten diese Punkte als Gründe dafür angeführt werden, die Wirksamkeit und Effizienz des Instruments in Zweifel zu ziehen.
Dabei gibt es zahlreiche Belege dafür, dass UN Friedensmissionen wirksam sind. Studien belegen, dass die UN-Friedenssicherung zum Schutz der Zivilbevölkerung beiträgt, einen Wiederausbruch von Bürgerkriegen verhindert, die Zahl der Todesopfer verringert, die Ausbreitung von Gewalt eindämmt und Flüchtlingsströme begrenzt. Darüber hinaus kann schon die Aussicht auf eine UN-Friedensmission eine Friedensvereinbarung erleichtern. Kritiker*innen führen die positiven Ergebnisse teils darauf zurück, dass Friedenstruppen vor allem in ‚einfachen Fällen‘ zum Einsatz kommen würden. Tatsächlich ist jedoch das Gegenteil der Fall: sie sind an den Frontlinien der schwersten Konflikte im Einsatz. Während es leicht ist, anzuprangern, wenn Angriffe auf Zivilist*innen von Friedenstruppen nicht verhindert werden konnten, ist es sehr viel komplizierter zu ermitteln, wie viele Angriffe dank der Präsenz der Friedenstruppen ausgeblieben sind. Wirksame Prävention ist äußerst kosteneffektiv, bleibt aber oft unsichtbar. Wissenschaftliche Studien können diesen „unsichtbaren“ Mehrwert ermitteln und zeigen deutlich, dass Friedensmissionen einen nachweisbaren Nutzen erbringen. Auch wenn UN-Friedensmissionen Probleme aufweisen, die gelöst werden müssen, sind sie ein wirksames Instrument zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Schaffung von Frieden.
Um die UN-Friedenssicherung zukunftsfähig zu machen, sind mehrere Aspekte entscheidend. Erstens müssen die Mandate der Missionen mit angemessenen Ressourcen unterlegt sein, um eine Lücke zwischen Anspruch und Fähigkeit zu vermeiden – denn diese schwächt die Wirksamkeit und gefährdet den Erfolg. Zweitens benötigen UN-Friedensmissionen „robuste“ Mandate für den Schutz der Zivilbevölkerung. Um einen dauerhaften Frieden zu fördern, sollten diese Mandate mit umfassenden friedensfördernden Maßnahmen einhergehen, wie dies beispielsweise in Liberia erfolgreich geschehen ist. Drittens muss anerkannt werden, dass die Zusammensetzung der Friedenstruppen Einfluss auf ihre Wirksamkeit hat. Sie erfordert daher systematische Planung und darf nicht bloß als logistische Frage betrachtet werden. Viertens ist vorausschauendes Handeln entscheidend, sowohl für den Erfolg der Mission, als auch für den Schutz der Zivilbevölkerung. Zu diesem Zweck muss die UN-Friedenssicherung ihre Frühwarnmechanismen modernisieren. Schließlich wurden in den letzten Jahren wichtige Fortschritte in punkto Geschlechtergerechtigkeit in Ausbildung und Missionsgestaltung gemacht, die angesichts des derzeitigen politischen Klimas bewusste Anstrengungen erfordern, um sie zu erhalten.
Beim Peacekeeping Ministerial müssen sich die Mitgliedstaaten erneut dazu verpflichten, das Instrument der UN-Friedenssicherung aktiv zu unterstützen. Die entsendeten Kräfte brauchen robuste und klar definierte Mandate, ausreichende Ressourcen und politische Rückendeckung. In einer zunehmend fragmentierten Welt können wir es uns nicht leisten, auf eines der zuverlässigsten Instrumente zur Schaffung und Erhaltung des Friedens zu verzichten.
Christoph Dworschak ist Evaluator am Deutschen Evaluierungsinstitut der Entwicklungszusammenarbeit (DEval)* und Leiter für Quantitative Methoden des Beyond Compliance Consortiums der University of York. Sein Forschungsschwerpunkt liegt in der Friedens- und Konfliktforschung. *Die Inhalte des Texts sind die persönlichen Ansichten des Autors und entsprechen nicht notwendigerweise der Position des DEval.
Karina Mross ist Senior Researcher bei IDOS. In ihrer Forschung untersucht sie, was zur Förderung von Frieden und gesellschaftlichem Zusammenhalt in von Konflikt betroffenen Kontexten beiträgt, mit einem Fokus auf Friedensförderung und politische Institutionen.